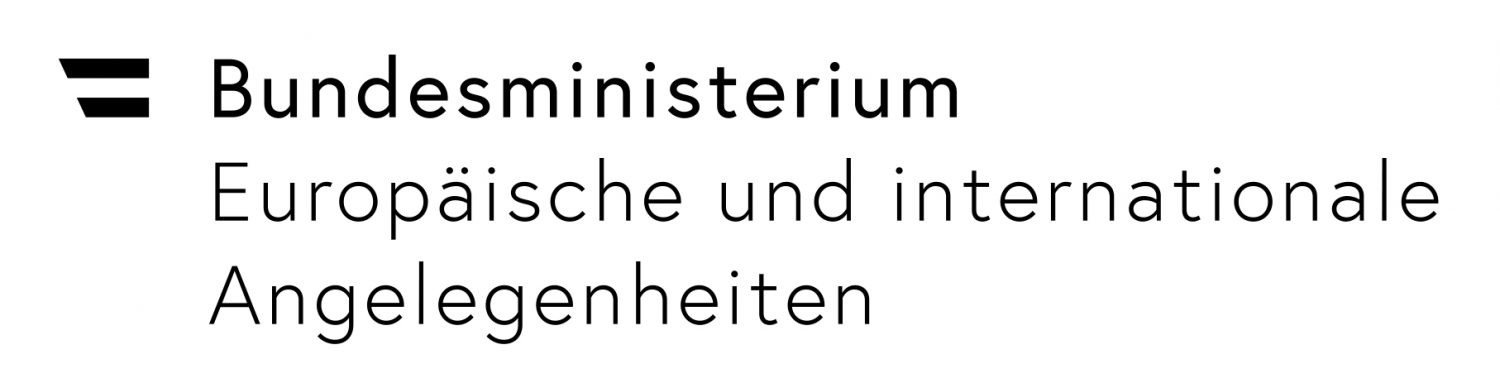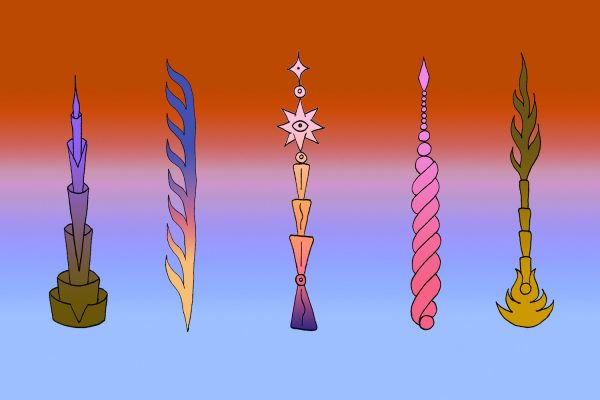Zukunft ist immer da, aber vielleicht am meisten präsent ist sie, wenn man in einem Krisenszenario gefangen bleibt, wenn man also, wie Kathrin Röggla im Frühjahr 2020 sagte, aus „der Taktung von jetzt, jetzt, jetzt“ kaum herauskommt. Wie selbstverständlich das Nach-vorne-Schauen zum Normalgefühl der Gegenwart gehört wird erst sichtbar und spürbar, wenn man durch das Angewiesensein auf Zukunftsprognosen „der Gegenwart enteignet wird“. Krisen bringen das Zeitgefühl durcheinander, davon lebt Literatur – nämlich davon, dass sie für den Zustand der Deregulierung des Zeitkontinuums Beschreibungsmodi findet. Zugleich aber lebt sie von der Freiheit, in der natürlichen Isolation der Schreibsituation Zeiten, Wirklichkeiten, Figuren und Sprachen zu (er)finden, die sich der Realität des Hier und Jetzt entziehen. Diese Freiheit atmen auch die hier versammelten Texte österreichischer Autor:innen – sie entwerfen kleinere und größere Zukünfte ohne Zeitdruck und ohne Gewähr, fern vom pandemischen Diskurs. Ich versuche, die Zukunftskreise, die sich dort abzeichnen, nachzuverfolgen.
Den ersten Kreis bilden private Zukünfte – Carolina Schutti und Friederike Gösweiner verorten ihre Plots in familiären Strukturen, wo die Zeit der Einzelnen immer mit den Schicksalen der Angehörigen verwoben ist. Was wird, ist innerhalb der Generationenabfolge und den jeweiligen emotionalen Verstrickungen (bei Schutti sind es Kinder einer Mutter, deren Väter tot sind) bis zu einem gewissen Grad vorherbestimmt. Aber nur bis zu einem gewissen Grad – dass sich das Werden der Kinder auf der Vorlage der Lebensgeschichte der Eltern entfaltet, suggeriert bei Schutti die Metapher des Palimpsests, der der Text seinen Titel verdankt. Palimpseste bestehen bekanntlich aus Schichten, die verschiedenartig beschriftet wurden – in den (zukünftigen) Lebenswegen von Kindern zeichnen sich zwar Spuren früherer Lebensschriften ab, aber es kommen auch neue Linien hinzu, darin liegt das große Versprechen jeder Zukunft. In Palimpsest bleibt das Konkrete der familiär vorgezeichneten Zukünfte – etwa: biologische Vererbung, Erbschaftsfragen – ausgespart, der Text lebt von einer subtilen Spannung in der Andeutung der Relation zwischen der Mutter und ihren zwei Töchtern. Er macht damit das Emotionale (und also: das Vage) zum Stoff. Anders Gösweiner in Regenbogenweiß, wo Zukunft zum einen im Akt der Verteilung von Gegenständen des verstorbenen Vaters als ein neuer Lebensabschnitt im Raum steht, zum anderen als das große Ungewisse in gesellschaftlichen Kategorien sich bemerkbar macht. Zukunft einer Familie sind Kinder, eine Nachkommenschaft, in der nicht nur Gesichtszüge und Gesten weitergereicht werden, sondern auch Optionen für die Entfaltung einer Gesellschaft.
Zukunft hat in diesem Romanfragment auch das Gesicht eines Roboters, der den Rasen der nun vaterlosen Familie mäht, und dabei einem Geflüchteten den Job wegnimmt, weil es manchmal einfacher sein kann, eine Maschine zu kaufen als einen Geflüchteten zu beschäftigen. Dabei funktioniert die künstliche Intelligenz gar nicht so, wie man sich das vorstellt, nämlich mit zukunftsträchtiger, müheloser Eleganz. Was auch nicht wirklich glatt funktioniert ist die Handhabung des erwünschten Merkmals der Zukunftsgesellschaft, der Diversität. Fragen, die die introvertierte Akademikerin Filippa in den Raum stellt, treffen den Nerv der Zeit: Was bedeutet eigentlich diversity management und wer darf es bestimmen? Darf man/frau bei universitären Diskussionen über Diversität in anderen Kategorien nachdenken, als die Mehrheit es tut? Und, nicht zuletzt: Kann man die Vielfalt einer Zukunftsgesellschaft am Reißbrett planen, wie man die Stundenverteilung plant?
Dass die Zukünfte niemals privat sind, legen Schutti und Gösweiner nahe, sie signalisieren auch, was die anderen Autor:innen durch Erweiterungen der Horizontkreise aufzeichnen. Bei Michael Stavarič im Text Visionen der Zukunft ist die Tonart poetisch, getaktet durch Enjambements, die seine Zweizeiler lyrisch anklingen lassen. Die Zukunftsvisionen sind dort geteilte Visionen eines Paares, und zugleich Erinnerungen an die lichte Gegenwart ihrer Entstehung – sie bringen die träumerische, dem Alltag abgewandte Dimension des Zukunftsdenkens ins Spiel. Und, sie erinnern, dass das Morgen, mit einem Du besprochen, besonders verlockend und besonders fragil sein kann. Dennoch – bei einer idyllischen Zweisamkeit bleibt es nicht. Als Zukunftsvisionen schieben sich auch „Schlaglöcher auf den Autobahnen“ und wachsende Mülldeponien ins Bild, friedvolle Pakte werden mit Ozean, Wald und dem Wind geschlossen; der Blick des Erzählers schweift bis hinauf zum Weltall, um damit die Erde als Zeugin und Erzeugerin der intimen Zukunft zu benennen.
Aus der Entfernung blickt auch der Erzähler bei Thomas Stangl, er entwickelt eine metaphysisch angehauchte, meditative Narration, aus einer flüchtigen intimen Erfahrung heraus und zugleich aus einem ebenso flüchtigen Verlustgefühl geboren. Zukunft heißt eine unbestimmte Erwartung des Kommenden, die als Option in unseren Biografien offen bleibt. So gibt Zukunft dem Leben Sinn, denn sie eröffnet einen konjunktivischen Raum, gefüllt mit Kontingenz, die sich zu starrer Lebensplanung querstellt. Was dieser Raum enthält, wissen wir nicht, wir können es nicht wissen, es liegt in den Sternen. Und so wie das Licht der Sterne uns nur blass und entfernt erreicht, mehr als eine Ahnung als eine Gewissheit der Existenz eines Lichtkörpers, so leuchtet eine nicht zu Ende ausgeführte Geste in Stangls poetischen Reflexionen. Der Raum der Zukunft erstrahlt hier in der Lichtmetaphorik, in Bildern kurzer Blitze, die vage Ahnungen des Kommenden genauso wie plötzliche Erleuchtung bedeuten mögen. Mit Rekurs auf den literarischen Meister der Zeitreflexion und seine Recherche du temps perdu reflektiert Stangl melancholisch über den individuellen Raum in der Zeit, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und über die Unmöglichkeit, etwas über Zukunft zu erfahren, sowie über die Aporie dieser Unmöglichkeit, weil man ja stets an der Schwelle der Zukunft lebt.
Der Zukunftskreis, den Claudia Tondl in Topographien der Vorstellungskraft vorzeichnet, hat eine politische Botschaft, er leuchtet in Regenbogenfarben – die Zukunft wird nicht schwarz-weiß imaginiert. Tondls Text entwirft ein Schreib-Szenario mit einem Du, das die Poetik für eine (bessere) Zukunftsgesellschaft malt – dazu gehört Mut, wie wir erinnert werden – aber eben auch Vorstellungskraft. Future literacy, explizit heraufbeschworen, soll die Horizonte erweitern, gerade heute, wo sie durch Grenzen und Ausschlusszonen schrumpfen. Einiges an diesem Programm scheint vertraut zu sein; ging es früher bei SF-Romanen nicht auch um Zukunftsentwürfe, stets auf der Basis dessen, was war bzw. was ist, und als Reflexion darüber? Tragen heute nicht auch und gerade Dystopien zu einer Bilanzierung des Bestehenden, in der sich Echos großer menschlicher Hoffnungen wiederfinden? Future literacy bei Tondl will aber Anderes – es geht weniger um Szenarien, die in nicht-möglichen Konstellationen die condition humaine in neuen Narrationen vorstellen, sondern vielmehr um Topographien, die wie unsere Realität eingerichtet sind. Topographien mit Schreibtisch, Lampe, Fenster und Baum. Ja, es klingt nach einer bescheidenen Utopie, oder zumindest nach einem Willen zu Verzauberung – Tondl verspricht: „am Ende des Regenbogens ist ein Schatz versteckt“.
Franziska Füchsls Spick in die Werkstatt fällt aus dem Rahmen der privaten und gesellschaftlichen Zukunftskreise. Gewissermaßen geht es in ihrem Text um alles: Füchsl bildet eine Metaphernwerkstatt, in der weiche (weibliche?) Körperlichkeit mit der Härte der Werkzeuge und Maschinen zusammengedacht wird. Durch Sinnliches fräst sich Metallisches, Assoziationen rund um den menschlichen Fleisch mit seinen Sekreten, Öffnungen, Reflexen rücken in Bereiche der Produktion, wo Teile sich ineinanderfügen. Wie nah sich Körper und Maschine sein können, demonstriert die Sprache, die durch Lautassoziationen entfernte Bereiche miteinander zusammenschweißt, die Lücken (nicht) verfugt. Es geht nicht um cyborg-mäßige Beschaffenheit unserer zukünftigen Körper – oder wenn schon, dann nur am Rande. Beim Lesen der zackigen, vibrierenden Sätze, die sich fremd und deshalb faszinierend anfühlen, kommt man ins Stocken und Stolpern, man fragt sich: Kann es sein, dass hier eine Sprachkunst der Zukunft auf der Werkstatt liegt? Ein „produktiver Missbrauch“, wie ihn auch Ann Cotten in ihrer Poetik betreibt, mit „Metaphern, die spürbare Bilder benutzen, den Körper aktivieren, Erinnerungen wecken“, und deshalb „bunter und plastischer“ sind? Wären Füchsls Reibungen zwischen körperlichen Lyrik und der Fachsprache des Maschinenbaus als Cottens „neue Metaphern“ zu denken?
Cotten versucht, ergonomische Metaphern zu (er)finden, d.h. Begriffe oder Phänomene aus den Naturwissenschaften für ein neues Denken in Sprachbildern produktiv zu machen. Grundsätzlich geht es dabei um Metaphern, die „als Mittel skeptischen Denkens“ genutzt werden können. Füchsls Kopplung der Bereiche „Körper“ und „Gerätschaft“ mit Ritzen und Wunden, die sich dabei ergeben, zeugt von einer ähnlichen Erkundungslust an den Rändern des sprachlich Möglichen. Der Sound, der dabei entsteht, ist im besten Sinn unrein, mehrsprachig, störrisch und störend.